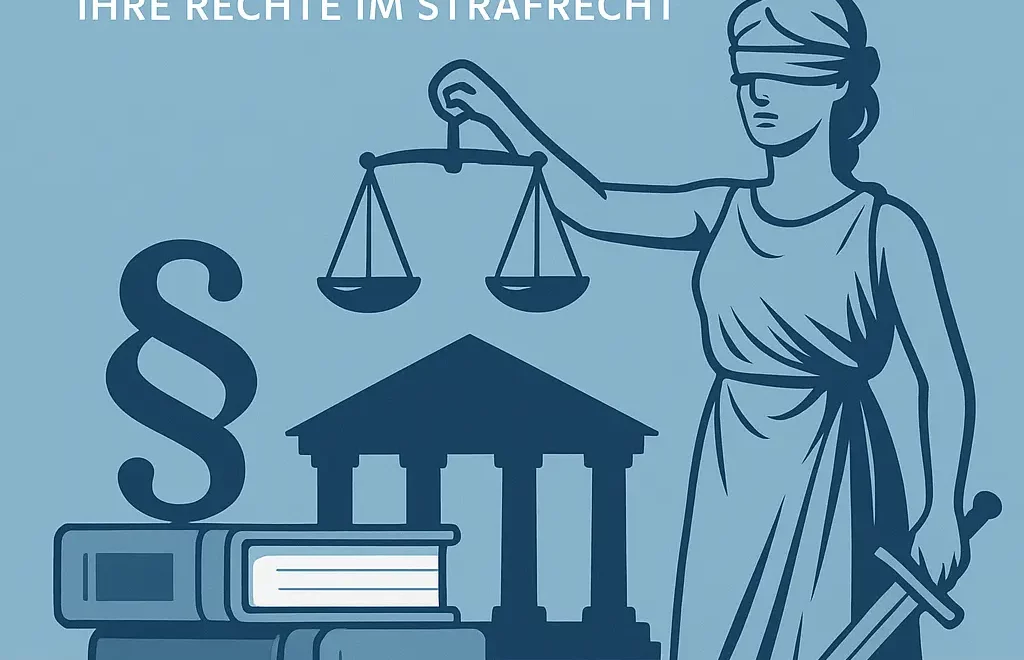
I. Das Recht auf Rechtsbeistand im Strafverfahren
A. Bedeutung der Verteidigung
Ein Strafverfahren stellt einen erheblichen Eingriff in das Leben eines Beschuldigten dar. Angesichts der Komplexität des deutschen Strafrechts und Strafprozessrechts ist eine effektive Verteidigung von entscheidender Bedeutung, um die Rechte des Beschuldigten zu wahren und ein faires Verfahren sicherzustellen. Das Recht gilt für alle gleichermaßen, und niemand soll aus finanzieller Not auf die Wahrnehmung seiner Rechte verzichten müssen. Für juristische Laien ist es oft schwierig, ohne fachkundigen Beistand die eigene Position optimal zu vertreten und alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.
B. Überblick über staatliche Unterstützungsmöglichkeiten
Der deutsche Staat sieht verschiedene Mechanismen vor, um Bürgern mit geringen finanziellen Mitteln den Zugang zu Rechtsrat und Rechtsvertretung zu ermöglichen. Im Kontext der Strafverteidigung sind insbesondere drei Instrumente relevant:
- Die Beratungshilfe für außergerichtlichen Rechtsrat.
- Die Prozesskostenhilfe (PKH) für gerichtliche Verfahren.
- Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers im Strafverfahren.
Diese drei Säulen der staatlichen Unterstützung unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihren Zwecken, Voraussetzungen und ihrer Anwendbarkeit im Strafverfahren aus Sicht des Beschuldigten. Ein klares Verständnis dieser Unterschiede ist essenziell, um zu erkennen, welche Hilfeform für die spezifische Situation eines Beschuldigten relevant ist und welche nicht.
C. Ziel dieser Information
Diese Mandanteninformation soll einen verständlichen Überblick über die Ansprüche auf Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe und Pflichtverteidigung im Rahmen einer strafrechtlichen Verteidigung bieten. Sie dient als Orientierungshilfe, um die jeweiligen Rechte und die nächsten möglichen Schritte besser einschätzen zu können. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Information eine individuelle Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt im Einzelfall nicht ersetzen kann. Im Zweifelsfall sprechen Sie mich bitte an.
II. Beratungshilfe: Finanzielle Unterstützung für außergerichtlichen Rechtsrat
A. Zweck und Umfang der Beratungshilfe
Die Beratungshilfe ist eine Form der Sozialleistung, die im Beratungshilfegesetz (BerHG) geregelt ist. Ihr Zweck ist es, Bürgern mit geringem Einkommen und Vermögen die Möglichkeit zu geben, sich außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens rechtlich beraten und unter Umständen auch vertreten zu lassen. Sie soll die Wahrnehmung von Rechten ermöglichen, wenn die dafür notwendigen finanziellen Mittel nicht aufgebracht werden können. Grundsätzlich kann Beratungshilfe für eine Vielzahl von Rechtsgebieten beantragt werden, darunter Zivilrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht und Verfassungsrecht.
B. Spezifische Einschränkung im Strafrecht
Für Beschuldigte in einem Strafverfahren ist eine wesentliche Einschränkung der Beratungshilfe zu beachten: In Angelegenheiten des Strafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts wird gemäß § 2 Absatz 2 BerHG ausschließlich Beratung gewährt, eine Vertretung nach außen ist ausgeschlossen.
Diese gesetzliche Beschränkung hat erhebliche praktische Konsequenzen für die Strafverteidigung. Die Kernaufgaben eines Strafverteidigers umfassen typischerweise die Korrespondenz mit Polizei und Staatsanwaltschaft, die Beantragung von Akteneinsicht, die Begleitung zu Vernehmungen und die Vertretung in der Hauptverhandlung vor Gericht. All diese Tätigkeiten gehen über eine reine Beratung hinaus und stellen eine Vertretung dar. Da § 2 Abs. 2 BerHG die Vertretung im Strafrecht explizit ausschließt, kann die Beratungshilfe die Kosten für diese zentralen Verteidigungsleistungen nicht decken.
Für Beschuldigte bedeutet dies, dass die Beratungshilfe zwar für ein erstes Orientierungsgespräch mit einem Anwalt genutzt werden kann – etwa zur Klärung des Tatvorwurfs, der eigenen Rechte (z.B. Aussageverweigerungsrecht), der Zweckmäßigkeit einer Aussage oder der Frage, ob die Voraussetzungen für eine Pflichtverteidigung vorliegen könnten. Sie bietet jedoch keine finanzielle Grundlage für die eigentliche, aktive Verteidigungsarbeit durch den Anwalt. Kosten für Schriftsätze an die Ermittlungsbehörden, die Verteidigung in einer Hauptverhandlung oder andere Vertretungshandlungen werden durch die Beratungshilfe im Strafrecht nicht abgedeckt.
C. Voraussetzungen für die Bewilligung
Um Beratungshilfe zu erhalten, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein :
- Finanzielle Bedürftigkeit:
Der Antragsteller kann die erforderlichen Mittel für die Rechtsberatung nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht selbst aufbringen. Das zuständige Amtsgericht prüft dies anhand der vorgelegten Nachweise über Einkommen, Vermögen und finanzielle Belastungen (z.B. Miete, Unterhalt). Es gelten bestimmte Freibeträge für Einkommen und Vermögen; nur geringes einzusetzendes Einkommen oder Vermögen darf vorhanden sein. Personen, die laufende Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) oder SGB XII (Sozialhilfe) beziehen, erfüllen diese Voraussetzung in der Regel. - Keine anderen zumutbaren Hilfsmöglichkeiten: Dem Antragsteller dürfen keine anderen zumutbaren und kostenlosen oder kostengünstigeren Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um Hilfe in der Rechtsangelegenheit zu erhalten. Geprüft wird beispielsweise, ob eine Rechtsschutzversicherung eintrittspflichtig ist oder ob eine kostenlose Beratung durch Verbände (z.B. Mieterverein, Gewerkschaft bei arbeitsrechtlichen Fragen) oder Behörden (z.B. Jugendamt, Schuldnerberatungsstellen) möglich und zumutbar ist. Auch eine mögliche Unterhaltspflicht des Ehegatten, Lebenspartners oder der Eltern kann der Bewilligung entgegenstehen.
- Keine Mutwilligkeit: Die Inanspruchnahme der Beratungshilfe darf nicht mutwillig erscheinen. Mutwilligkeit liegt vor, wenn eine Person, die die Kosten selbst tragen müsste, unter vernünftigen Erwägungen davon absehen würde, Rechtsrat einzuholen.
- Notwendigkeit rechtlicher Hilfe: Es muss sich um eine konkrete rechtliche Angelegenheit handeln. Beratungshilfe wird nicht für allgemeine Lebenshilfe oder zur Kompensation von Sprach-, Lese- oder Schreibschwierigkeiten gewährt.
D. Antragsverfahren
Der Antrag auf Beratungshilfe ist beim Amtsgericht zu stellen, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz hat. Der Antrag kann entweder schriftlich unter Verwendung des dafür vorgesehenen amtlichen Formulars eingereicht werden oder mündlich zur Niederschrift bei der Rechtsantragstelle des Amtsgerichts gestellt werden. Eine Antragstellung per Telefon oder E-Mail ist nicht zulässig.
Es gibt zwei Wege, Beratungshilfe in Anspruch zu nehmen:
- Antrag vor dem Anwaltsbesuch: Der Antragsteller geht zuerst zum Amtsgericht und beantragt dort die Beratungshilfe. Wird sie bewilligt, erhält er einen Berechtigungsschein. Mit diesem Schein kann er dann einen Rechtsanwalt seiner Wahl aufsuchen.
- Nachträglicher Antrag: Der Antragsteller geht direkt zu einem Rechtsanwalt und bittet um Beratung unter Hinweis auf seine Absicht, Beratungshilfe zu beantragen. Der Antrag auf Bewilligung muss dann nachträglich beim Amtsgericht gestellt werden. Hierbei ist äußerste Vorsicht geboten: Der nachträgliche Antrag muss spätestens vier Wochen nach Beginn der Beratungstätigkeit durch den Anwalt beim Amtsgericht eingegangen sein. Wird diese Frist versäumt, kann keine Beratungshilfe mehr bewilligt werden.
Die nachträgliche Antragstellung birgt ein erhebliches Kostenrisiko für den Rechtssuchenden. Wird der Antrag vom Gericht abgelehnt (sei es wegen Fristversäumnis oder weil die Voraussetzungen nicht vorlagen), kann der Anwalt, der bereits beratend tätig wurde, seine regulären Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) vom Mandanten verlangen, sofern er diesen bei Mandatsübernahme auf dieses Risiko hingewiesen hat. Der sicherste Weg, um dieses finanzielle Risiko zu vermeiden, ist daher, zuerst den Berechtigungsschein beim Amtsgericht zu beantragen und diesen dann dem Anwalt vorzulegen. Nur wenn eine Angelegenheit sehr eilig ist, sollte der Weg über den nachträglichen Antrag erwogen werden, wobei die Einhaltung der Vier-Wochen-Frist höchste Priorität hat.
Für den Antrag sind umfassende Unterlagen beizufügen, um die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie das Rechtsproblem darzulegen. Dazu gehören typischerweise:
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass (ggf. mit Meldebescheinigung)
- Nachweise über Einkünfte (z.B. Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten Monate, Bescheide über Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente)
- Mietvertrag und Nachweis der aktuellen Miethöhe
- Vollständige Kontoauszüge (meist der letzten drei Monate)
- Belege über laufende Zahlungsverpflichtungen (z.B. Kredite, Versicherungen) und besondere Belastungen
- Nachweise über vorhandenes Vermögen (z.B. Sparbücher, Bausparverträge, Lebensversicherungen mit Rückkaufswert)
- Unterlagen, die das Rechtsproblem betreffen (z.B. Schreiben von Behörden, Schriftverkehr mit der Gegenseite)
E. Kosten
Das gerichtliche Verfahren zur Prüfung und Bewilligung der Beratungshilfe ist für den Antragsteller kostenlos. Wird die Beratungshilfe bewilligt und ein Rechtsanwalt tätig, kann dieser vom Mandanten eine Gebühr in Höhe von 15 Euro erheben. Alle weiteren Kosten für die anwaltliche Beratung (im Rahmen der Bewilligung) trägt die Staatskasse.
F. Ablehnung und Rechtsmittel
Lehnt das Amtsgericht (der zuständige Rechtspfleger) den Antrag auf Beratungshilfe ab, muss dies nicht hingenommen werden. Gegen die Ablehnung kann das Rechtsmittel der Erinnerung eingelegt werden. Die Erinnerung muss schriftlich beim Amtsgericht eingereicht und begründet werden. In der Praxis erfolgt ein Hinweis auf dieses Rechtsmittel oft nur bei schriftlichen Ablehnungsbescheiden, bei mündlichen Ablehnungen oder Hinweisen auf die Aussichtslosigkeit eines Antrags unterbleibt er manchmal.
III. Prozesskostenhilfe (PKH): Finanzielle Hilfe für Gerichtsverfahren – Relevant für Beschuldigte?
A. Grundsätzlicher Zweck der PKH
Die Prozesskostenhilfe (PKH), früher auch als „Armenrecht“ bezeichnet, ist in der Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt (§§ 114 ff. ZPO). Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass niemand aus Mangel an finanziellen Mitteln davon abgehalten wird, seine Rechte vor Gericht zu verfolgen oder sich gegen Ansprüche anderer gerichtlich zu verteidigen. PKH kann die Kosten des Gerichtsverfahrens (Gerichtskosten) und die Kosten für den eigenen Rechtsanwalt abdecken, sofern dessen Beiordnung durch das Gericht für erforderlich gehalten wird. Abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers kann die PKH die Kosten vollständig übernehmen oder es können monatliche Ratenzahlungen festgesetzt werden.
B. Die entscheidende Einschränkung für Beschuldigte im Strafverfahren
Für Personen, die in einem Strafverfahren als Beschuldigte geführt werden, ist die wichtigste Information bezüglich der PKH: Für die Kosten der eigenen Verteidigung gegen den Strafvorwurf wird einem Beschuldigten grundsätzlich keine Prozesskostenhilfe nach der Zivilprozessordnung gewährt.
Der Grund für diese klare Abgrenzung liegt in der unterschiedlichen Struktur des deutschen Prozessrechts. Die PKH ist ein Instrument der Zivilprozessordnung (ZPO) und verwandter Verfahrensordnungen (z.B. VwGO, ArbGG, SGG), die primär für zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche, arbeitsrechtliche oder sozialrechtliche Streitigkeiten konzipiert ist. Das Strafverfahren folgt jedoch eigenen Regeln, die in der Strafprozessordnung (StPO) niedergelegt sind. Für die Sicherstellung der Verteidigung von Beschuldigten in bestimmten, als besonders relevant erachteten Fällen sieht die StPO ein eigenständiges System vor: die notwendige Verteidigung und die damit verbundene Beiordnung eines Pflichtverteidigers (§§ 140 ff. StPO). Dieses System der Pflichtverteidigung hat Vorrang und schließt die Anwendung der PKH nach der ZPO für die Finanzierung der Verteidigungskosten des Beschuldigten aus. Die Pflichtverteidigung soll gewährleisten, dass in Fällen, in denen der Staat dem Bürger mit dem Vorwurf einer Straftat gegenübertritt und eine effektive Verteidigung als unerlässlich gilt (z.B. wegen der Schwere des Vorwurfs oder der Komplexität des Falls), ein Verteidiger zur Verfügung steht – und zwar unabhängig von der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten. Die Notwendigkeit wird anhand objektiver Kriterien des Falles bemessen (§ 140 StPO), nicht primär anhand der finanziellen Situation.
Für Beschuldigte im Strafverfahren bedeutet dies unmissverständlich: Es ist nicht zielführend, einen Antrag auf Prozesskostenhilfe für die eigene Verteidigung zu stellen. Ein solcher Antrag wäre von vornherein aussichtslos und würde lediglich zu Verzögerungen führen. Die relevante staatliche Unterstützung für die Verteidigung in bestimmten Fällen ist die Pflichtverteidigung.
C. Ausnahmen: Wann PKH im Strafverfahren doch relevant sein kann (aber nicht für die Verteidigung des Beschuldigten)
Obwohl PKH für die Verteidigung des Beschuldigten selbst nicht zur Verfügung steht, kann sie in bestimmten Konstellationen innerhalb eines Strafverfahrens für andere Beteiligte relevant sein:
- Opfer als Nebenkläger: Opfer bestimmter Straftaten haben das Recht, sich dem Strafverfahren als Nebenkläger anzuschließen, um ihre Interessen aktiv zu vertreten. Für die Kosten ihres anwaltlichen Beistands können sie unter den Voraussetzungen des § 397a Abs. 2 StPO Prozesskostenhilfe beantragen.
- Privatkläger: Bei bestimmten Delikten (z.B. Hausfriedensbruch, Beleidigung) kann die Strafverfolgung ausnahmsweise im Wege der Privatklage durch den Verletzten erfolgen. Auch der Privatkläger kann hierfür PKH nach den Vorschriften der ZPO beantragen.
- Adhäsionsverfahren: Opfer einer Straftat können unter Umständen ihre zivilrechtlichen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche direkt im Strafprozess gegen den Beschuldigten geltend machen (sog. Adhäsionsverfahren). Für die Durchsetzung dieser Ansprüche im Adhäsionsverfahren können sie ebenfalls PKH beantragen.
Es ist wichtig zu betonen, dass diese Ausnahmen ausschließlich die Kosten anderer Verfahrensbeteiligter betreffen und keine finanzielle Hilfe für die Verteidigung des Beschuldigten darstellen.
D. Allgemeine PKH-Voraussetzungen (zur Information für die Ausnahmefälle)
Für die oben genannten Ausnahmefälle (Nebenkläger, Privatkläger, Adhäsionskläger) gelten die allgemeinen Voraussetzungen der PKH nach §§ 114 ff. ZPO:
- Persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse: Der Antragsteller muss nachweisen, dass er die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Die Prüfung erfolgt ähnlich wie bei der Beratungshilfe anhand von Einkommen, Vermögen und Belastungen. Es gibt einen Vermögensfreibetrag (Stand 2023: 10.000 Euro). Einkommen über den Freibeträgen ist einzusetzen, was zu Ratenzahlungen führen kann. Ein eventueller Anspruch auf Prozesskostenvorschuss gegen den Ehegatten oder unterhaltsverpflichtete Eltern hat Vorrang vor der PKH.
- Hinreichende Erfolgsaussicht: Die beabsichtigte Rechtsverfolgung (z.B. die Geltendmachung von Ansprüchen im Adhäsionsverfahren) muss eine realistische, „hinreichende“ Aussicht auf Erfolg bieten.
- Keine Mutwilligkeit: Die Rechtsverfolgung darf nicht mutwillig erscheinen. Dies ist der Fall, wenn eine verständige, selbst zahlende Partei von der Rechtsverfolgung absehen würde.
E. Kostenrisiken trotz Prozesskostenhilfe
Selbst wenn PKH bewilligt wird, deckt sie nicht alle potenziellen Kostenrisiken ab. Ein zentraler Punkt ist: Die PKH befreit nicht von der Pflicht, im Falle des Unterliegens die Kosten der gegnerischen Partei zu tragen. Verliert also beispielsweise ein Nebenkläger, dem PKH bewilligt wurde, einen Teil des Verfahrens, für den Kosten anfallen, oder wird ein Adhäsionsantrag abgewiesen, muss er unter Umständen die dadurch entstandenen Kosten des Beschuldigten (z.B. dessen Anwaltskosten für die Verteidigung gegen den Adhäsionsantrag) erstatten. Eine Ausnahme hiervon besteht in der ersten Instanz der Arbeitsgerichtsbarkeit, wo jede Partei ihre Anwaltskosten selbst trägt, unabhängig vom Ausgang.
Darüber hinaus kann das Gericht die wirtschaftlichen Verhältnisse des PKH-Empfängers bis zu vier Jahre nach Abschluss des Verfahrens überprüfen. Verbessern sich die Verhältnisse wesentlich, kann das Gericht nachträglich Ratenzahlungen anordnen oder bereits festgesetzte Raten erhöhen. Umgekehrt kann bei Verschlechterung eine Reduzierung oder der Wegfall von Raten möglich sein. Es besteht eine gesetzliche Pflicht, dem Gericht wesentliche Verbesserungen der wirtschaftlichen Verhältnisse (bei laufenden Einkünften z.B. eine dauerhafte Verbesserung um mehr als 100 Euro brutto monatlich) sowie Adressänderungen unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Ein Verstoß gegen diese Mitteilungspflicht kann zur Aufhebung der PKH-Bewilligung führen, mit der Folge, dass die gesamten Kosten nachzuzahlen sind.
IV. Pflichtverteidigung: Notwendige Verteidigung in Strafverfahren
A. Zweck und Grundsatz
Die Pflichtverteidigung ist das zentrale Instrument im deutschen Strafprozessrecht, um eine effektive Verteidigung von Beschuldigten in bestimmten Fällen sicherzustellen. Ihr Ziel ist es, ein faires Verfahren gemäß den rechtsstaatlichen Grundsätzen zu gewährleisten, insbesondere das Prinzip der „Waffengleichheit“ zwischen der Anklage (Staatsanwaltschaft) und dem Beschuldigten. Die Beiordnung eines Pflichtverteidigers erfolgt in den gesetzlich definierten Fällen der sogenannten notwendigen Verteidigung (§ 140 StPO), in denen der Gesetzgeber die Mitwirkung eines Verteidigers für unerlässlich hält – sei es wegen der Schwere des Tatvorwurfs, der Komplexität des Verfahrens oder der persönlichen Situation des Beschuldigten.
Der entscheidende Unterschied zur Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe liegt darin, dass die Beiordnung eines Pflichtverteidigers grundsätzlich unabhängig von den finanziellen Verhältnissen (Einkommen und Vermögen) des Beschuldigten erfolgt. Maßgeblich sind allein die in § 140 StPO genannten objektiven Kriterien, die eine Verteidigung als notwendig erscheinen lassen. Das bedeutet, auch ein finanziell gut gestellter Beschuldigter erhält in einem Fall der notwendigen Verteidigung einen Pflichtverteidiger vom Gericht bestellt, wenn er sich nicht selbst zuvor einen Wahlverteidiger genommen hat. Die Pflichtverteidigung ist somit kein „Armenrecht“, sondern eine Verfahrensgarantie.
B. Wann wird ein Pflichtverteidiger bestellt? (Fälle der „notwendigen Verteidigung“ nach § 140 StPO)
Die Strafprozessordnung (StPO) legt in § 140 fest, wann ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt und somit (sofern der Beschuldigte noch keinen Wahlverteidiger hat) ein Pflichtverteidiger bestellt werden muss. Man unterscheidet zwischen den Katalogfällen des Absatzes 1 und der Generalklausel des Absatzes 2.
1. Katalogfälle (§ 140 Abs. 1 StPO): In den folgenden Fällen ist die Verteidigung notwendig :
- Zuständigkeit höherer Gerichte: Wenn zu erwarten ist, dass die Hauptverhandlung im ersten Rechtszug vor dem Oberlandesgericht, dem Landgericht oder dem Schöffengericht (beim Amtsgericht) stattfindet (Nr. 1).
- Verbrechensvorwurf: Wenn dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird (Nr. 2). Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht ist (§ 12 Abs. 1 StGB).
- Drohendes Berufsverbot: Wenn das Verfahren zu einem Berufsverbot führen kann (Nr. 3).
- Vorführung zur Haftentscheidung: Wenn der Beschuldigte einem Gericht zur Entscheidung über Haft (z.B. Untersuchungshaft, § 115, 115a StPO) oder einstweilige Unterbringung (z.B. in einer psychiatrischen Klinik, § 126a StPO) vorgeführt werden soll (Nr. 4).
- Freiheitsentzug in einer Anstalt: Wenn sich der Beschuldigte aufgrund richterlicher Anordnung oder mit richterlicher Genehmigung in einer Anstalt befindet (Nr. 5). Dies umfasst Untersuchungshaft, Strafhaft, Maßregelvollzug oder auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
- Unterbringung zur Begutachtung: Wenn zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand des Beschuldigten seine Unterbringung nach § 81 StPO in Frage kommt (Nr. 6).
- Erwartetes Sicherungsverfahren: Wenn zu erwarten ist, dass ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird (Nr. 7). Dies ist der Fall, wenn der Beschuldigte zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sein könnte, aber die Anordnung einer Maßregel der Besserung und Sicherung (z.B. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus) im Raum steht.
- Ausschluss des bisherigen Verteidigers: Wenn der bisherige Verteidiger durch eine gerichtliche Entscheidung von der Mitwirkung im Verfahren ausgeschlossen wurde (Nr. 8).
- Anwaltlicher Beistand für den Verletzten: Wenn dem Verletzten (Opfer) der Tat nach bestimmten Vorschriften (§§ 397a, 406h Abs. 3, 4 StPO) ein Rechtsanwalt als Beistand beigeordnet worden ist (Nr. 9).
- Bedeutsame richterliche Vernehmung: Wenn bei einer richterlichen Vernehmung die Mitwirkung eines Verteidigers aufgrund der besonderen Bedeutung der Vernehmung zur Wahrung der Rechte des Beschuldigten geboten erscheint (Nr. 10).
- Antrag bei Sinnesbehinderung: Wenn ein seh-, hör- oder sprachbehinderter Beschuldigter die Bestellung eines Verteidigers beantragt (Nr. 11).
2. Generalklausel (§ 140 Abs. 2 StPO): Auch wenn keiner der oben genannten Katalogfälle vorliegt, kann die Verteidigung notwendig sein. Dies ist der Fall, wenn :
- wegen der Schwere der Tat die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint.
- wegen der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge die Mitwirkung geboten erscheint. Als Richtwert gilt hier oft eine zu erwartende Freiheitsstrafe von etwa einem Jahr, aber auch darunter liegende Strafen können dies begründen, wenn schwerwiegende Nebenfolgen drohen (z.B. Widerruf einer Bewährung aus einer früheren Verurteilung, Verlust des Arbeitsplatzes, aufenthaltsrechtliche Konsequenzen wie Ausweisung).
- wegen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung geboten erscheint. Dies kann bei komplexen Beweiserhebungen (z.B. Sachverständigengutachten), unübersichtlichen Aktenlagen, ungeklärten Rechtsfragen oder in speziellen Rechtsgebieten wie dem Steuerstrafrecht der Fall sein.
- wenn ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Dies betrifft Fälle, in denen der Beschuldigte aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten oder seines Zustands nicht in der Lage ist, seine Rechte im Verfahren effektiv wahrzunehmen. Beispiele sind erhebliche geistige oder psychische Beeinträchtigungen (z.B. diagnostizierte Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Suchterkrankungen mit Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit), Analphabetismus, erhebliche Sprachbarrieren (auch trotz Dolmetscher), oder wenn der Beschuldigte unter Betreuung steht (insbesondere mit Aufgabenkreis „Vertretung vor Behörden“). Wichtig ist hierbei: Es müssen bereits erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Selbstverteidigung bestehen; eine vollständige Unfähigkeit ist nicht erforderlich. Die finanzielle Notlage des Beschuldigten ist für sich genommen kein Kriterium für die Anwendung des § 140 Abs. 2 StPO.
In vielen klaren Fällen des § 140 Abs. 1 StPO (z.B. Anklage zum Landgericht, Untersuchungshaft) wird das Gericht von Amts wegen prüfen, ob ein Pflichtverteidiger zu bestellen ist, wenn der Beschuldigte noch keinen Wahlverteidiger hat. Bei den flexibleren Kriterien des § 140 Abs. 2 StPO (Schwere der Tat/Rechtsfolge, Schwierigkeit, Unfähigkeit zur Selbstverteidigung) ist dies jedoch nicht immer sofort offensichtlich oder wird vom Gericht möglicherweise anders eingeschätzt als vom Beschuldigten. Da der Beschuldigte aber ein eigenes Antragsrecht auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers hat , sollte nicht passiv abgewartet werden. Es ist ratsam, frühzeitig – gegebenenfalls nach Einholung von Erstberatung über Beratungshilfe – durch einen Rechtsanwalt prüfen zu lassen, ob die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung vorliegen. Ist dies der Fall, sollte über den Anwalt ein entsprechender Antrag auf Beiordnung gestellt werden. Über einen solchen Antrag muss das Gericht bzw. die Staatsanwaltschaft zügig entscheiden, spätestens jedoch vor einer geplanten Vernehmung des Beschuldigten oder einer Gegenüberstellung.
Die Bestellung (auch Beiordnung genannt) eines Pflichtverteidigers erfolgt durch einen gerichtlichen Beschluss. Dies geschieht entweder:
- Auf Antrag des Beschuldigten: Der Beschuldigte kann jederzeit im Verfahren die Bestellung eines Pflichtverteidigers beantragen, wenn er der Ansicht ist, dass ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt.
- Von Amts wegen: In bestimmten gesetzlich festgelegten Situationen muss das Gericht oder die Staatsanwaltschaft auch ohne Antrag tätig werden und prüfen, ob ein Pflichtverteidiger zu bestellen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Beschuldigte zur Entscheidung über Haft vorgeführt werden soll, wenn bekannt wird, dass er sich in einer Anstalt befindet, oder wenn im Ermittlungsverfahren ersichtlich wird, dass er sich nicht selbst verteidigen kann.
Grundsätzlich soll die Bestellung unverzüglich erfolgen, sobald die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung vorliegen und der Beschuldigte (noch) keinen Verteidiger hat. Besonders wichtig ist dies bei der Vorführung zur Haftentscheidung (§ 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO): Hier muss die Bestellung bereits vor der Vorführung erfolgen, damit der Verteidiger den Beschuldigten beraten und bei der Anhörung unterstützen kann. Auch eine nachträgliche Bestellung kann unter Umständen noch erfolgen, wenn die Voraussetzungen bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vorlagen, die Entscheidung aber verzögert wurde.
Ein zentrales Recht des Beschuldigten im Bestellungsverfahren ist das Recht auf Auswahl des Pflichtverteidigers. Bevor das Gericht von Amts wegen einen Pflichtverteidiger auswählt, muss es dem Beschuldigten Gelegenheit geben, innerhalb einer angemessenen Frist selbst einen Rechtsanwalt seines Vertrauens zu benennen.
Dieses Wahlrecht ist von großer praktischer Bedeutung. Das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant ist eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Verteidigungsstrategie. Wird vom Gericht ein Anwalt ausgewählt, zu dem der Beschuldigte kein Vertrauen aufbauen kann, kann dies die Zusammenarbeit und den Erfolg der Verteidigung erheblich beeinträchtigen. Zwar wählt das Gericht in der Regel aus einem bei der Rechtsanwaltskammer geführten Verzeichnis geeignete Anwälte (insbesondere Fachanwälte für Strafrecht oder Anwälte, die ihr Interesse an Pflichtverteidigungen bekundet haben) aus , doch die „Chemie“ muss stimmen. Das Wahlrecht gibt dem Beschuldigten die Möglichkeit, selbst über diese wichtige Personalie zu entscheiden. Es sollte daher unbedingt Gebrauch davon gemacht werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig einen geeigneten Rechtsanwalt (möglichst einen Fachanwalt für Strafrecht) zu suchen, der bereit ist, das Mandat als Pflichtverteidiger zu übernehmen. Dessen Name sollte dem Gericht dann fristgerecht mitgeteilt werden. Das Gericht ist an diese Wahl gebunden, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der der Bestellung des benannten Anwalts entgegensteht (z.B. dieser ist nicht erreichbar, hat keine Zeit oder es besteht ein Interessenkonflikt). Wird die Frist versäumt oder kein Anwalt benannt, wählt das Gericht einen Pflichtverteidiger aus.
Ein Wechsel des bereits bestellten Pflichtverteidigers ist nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich. Ein Grund kann sein, dass das Gericht das Wahlrecht des Beschuldigten verletzt hat (z.B. die Frist zur Benennung war zu kurz oder es erfolgte keine Anhörung). In diesem Fall muss der Antrag auf Wechsel innerhalb von drei Wochen nach Bekanntgabe der Bestellung gestellt werden. Weitere Gründe für einen Wechsel können die endgültige Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zwischen Verteidiger und Beschuldigtem oder andere Umstände sein, die eine angemessene Verteidigung nicht mehr gewährleisten. Ein Wechsel ist jedoch nicht dazu gedacht, das Verfahren zu verzögern oder bloßen Unannehmlichkeiten abzuhelfen.
D. Kosten der Pflichtverteidigung
Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass ein Pflichtverteidiger den Beschuldigten nichts kostet. Dies ist nur teilweise richtig und hängt entscheidend vom Ausgang des Verfahrens ab.
- Vorschuss durch die Staatskasse: Zunächst werden die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Pflichtverteidigers immer von der Staatskasse bezahlt. Dies stellt sicher, dass der Anwalt seine Tätigkeit aufnehmen und durchführen kann, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit des Beschuldigten.
- Rückzahlungspflicht bei Verurteilung: Wird der Beschuldigte im Strafverfahren rechtskräftig verurteilt, so hat er gemäß § 465 StPO die Kosten des Verfahrens zu tragen. Zu diesen Verfahrenskosten gehören auch die Gebühren und Auslagen des Pflichtverteidigers. Die Staatskasse, die diese Kosten zunächst verauslagt hat, wird sie vom Verurteilten zurückfordern. Gegebenenfalls können Ratenzahlungen mit der Justizkasse vereinbart werden.
- Keine Kosten bei Freispruch: Wird der Beschuldigte hingegen freigesprochen oder das Verfahren aus anderen Gründen auf Kosten der Staatskasse endgültig eingestellt (z.B. nach § 170 Abs. 2 StPO oder § 153a Abs. 2 StPO mit Zustimmung des Gerichts), so trägt die Staatskasse die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen des Beschuldigten. In diesem Fall muss der Freigesprochene die an die Staatskasse gezahlten Pflichtverteidigergebühren nicht zurückzahlen.
Es ist somit entscheidend zu verstehen, dass die Pflichtverteidigung im Falle einer Verurteilung keine kostenlose Verteidigung darstellt. Sie ist vielmehr eine Vorfinanzierung durch den Staat, die sicherstellt, dass die Verteidigung durchgeführt werden kann. Die finanzielle Last trägt bei einer Verurteilung letztlich der Beschuldigte selbst. Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer engagierten und professionellen Verteidigung, die auf einen Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens abzielt.
Die Höhe der Gebühren eines Pflichtverteidigers richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Die gesetzlichen Gebührensätze für Pflichtverteidiger sind in der Regel niedriger als die sogenannten Wahlanwaltsgebühren (oft liegen sie bei ca. 80% der Mittelgebühr eines Wahlverteidigers). Wird der Beschuldigte freigesprochen, kann der Pflichtverteidiger unter Umständen die Differenz zu den höheren Wahlanwaltsgebühren ebenfalls von der Staatskasse erstattet verlangen. Es ist möglich, dass der Pflichtverteidiger mit dem Beschuldigten eine zusätzliche Honorarvereinbarung trifft, die über die gesetzlichen Pflichtverteidigergebühren hinausgeht. Solche zusätzlichen Honorare muss der Beschuldigte jedoch immer selbst tragen, unabhängig vom Verfahrensausgang.
Eine Besonderheit gilt im Jugendstrafrecht: Hier kann das Gericht gemäß § 74 JGG davon absehen, dem verurteilten Jugendlichen oder Heranwachsenden die Kosten des Verfahrens – und damit auch die Pflichtverteidigerkosten – aufzuerlegen. Dies geschieht in der Praxis häufig aus erzieherischen Erwägungen.
V. Zusammenfassung
A. Gegenüberstellung der Hilfeformen
Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede zwischen Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe (für die Verteidigung des Beschuldigten) und Pflichtverteidigung zusammen:
| Merkmal | Beratungshilfe (§§ 1 ff. BerHG) | Prozesskostenhilfe (§§ 114 ff. ZPO) (für Beschuldigten-Verteidigung) | Pflichtverteidigung (§§ 140 ff. StPO) |
|---|---|---|---|
| Hauptzweck | Außergerichtliche Rechtsberatung (ggf. Vertretung) bei Bedürftigkeit | Gerichtliche Rechtsverfolgung/-verteidigung bei Bedürftigkeit | Sicherstellung effektiver Verteidigung & fairen Verfahrens in gesetzlich definierten Fällen |
| Anwendbarkeit für Verteidigungskosten des Besch. | Nur Beratung, keine Vertretung im Strafrecht | Nein, nicht für die Verteidigungskosten des Beschuldigten | Ja, in Fällen der notwendigen Verteidigung (§ 140 StPO) |
| Finanzielle Bedürftigkeit Voraussetzung? | Ja | (Ja, aber irrelevant für Verteidigung) | Nein (abhängig von Notwendigkeit der Verteidigung) |
| Was wird übernommen? (Art der Kosten) | Kosten für außergerichtliche Beratung (max. 15 € Eigenanteil) | (Gerichtskosten, eigene Anwaltskosten – nicht für Verteidigung) | Gesetzliche Gebühren & Auslagen des beigeordneten Anwalts |
| Wer zahlt initial? | Staatskasse (abzgl. 15 € Eigenanteil) | (Staatskasse – nicht für Verteidigung) | Staatskasse |
| Rückzahlungspflicht bei Verurteilung? | Nein (für bewilligte Beratung) | (Irrelevant für Verteidigung) | Ja, Verurteilter muss Staatskasse die Kosten erstatten |
| Rückzahlungspflicht bei Freispruch? | Nein | (Irrelevant für Verteidigung) | Nein, Staatskasse trägt Kosten |
| Gesetzliche Grundlage (Hauptnormen) | BerHG | ZPO | StPO |
Die Beratungshilfe kann für ein erstes Informationsgespräch mit einem Anwalt nützlich sein, deckt aber nicht die Kosten der eigentlichen Verteidigungstätigkeit im Strafverfahren. Die Prozesskostenhilfe (PKH) nach der Zivilprozessordnung ist für die Finanzierung der eigenen Verteidigungskosten im Strafverfahren nicht anwendbar. Die Pflichtverteidigung ist das relevante Instrument in schwerwiegenderen oder komplexen Strafverfahren. Ihre Beiordnung hängt nicht von der finanziellen Situation ab, sondern von der gesetzlich definierten Notwendigkeit der Verteidigung. Im Falle einer Verurteilung müssen die Kosten des Pflichtverteidigers jedoch an die Staatskasse zurückgezahlt werden. Das Recht, den Pflichtverteidiger selbst vorzuschlagen, sollte unbedingt genutzt werden.
Angesichts der Komplexität des Strafverfahrens und der potenziell schwerwiegenden Folgen ist es dringend anzuraten, so früh wie möglich einen auf Strafrecht spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren. Es sollte vom Schweigerecht gegenüber den Ermittlungsbehörden Gebrauch gemacht werden, bis eine anwaltliche Beratung stattgefunden hat.
Ein erfahrener Strafverteidiger kann die individuelle Situation prüfen, aufklären, ob die Voraussetzungen für Beratungshilfe oder die Beiordnung eines Pflichtverteidigers vorliegen, und die notwendigen Anträge stellen. Zudem kann er eine effektive Verteidigungsstrategie entwickeln.
Diese Mandanteninformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und dient der allgemeinen Information über die staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Strafverteidigung. Sie kann und soll jedoch eine individuelle Rechtsberatung durch einen qualifizierten Rechtsanwalt im konkreten Einzelfall nicht ersetzen. Die Rechtslage kann sich ändern, und die Beurteilung jedes Falles hängt von seinen spezifischen Umständen ab. Für eine verbindliche Einschätzung der persönlichen Situation und zur bestmöglichen Wahrung der Rechte ist ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt unerlässlich. Es wird keine Haftung für Entscheidungen übernommen, die ausschließlich auf Grundlage dieser allgemeinen Informationen getroffen werden.
